"Die haben an mich geglaubt“
Ein früher Anrufer der Telefonseelsorge schildert seinen Weg zurück ins Leben.
Auszug aus einer Festschrift der Telefonseelsorge Salzburg.
"Von einem Bahnhofsandler trennt mich nur ein Seidel Bier.“
Ferdinand weiß, wovon er spricht. Dem Handwerksmeister in der schön eingerichteten Wohnung sieht man seine Vergangenheit nicht an. Dass er seine „Alkoholiker-Karriere“ zu einem Wendepunkt brachte, verdankt er der Telefonseelsorge. Das betont er immer wieder. "Die haben an mich geglaubt, und die wollte ich nicht enttäuschen.“
Die Kindheit war nicht schön, der Vater war Alkoholiker, und Ferdinand hatte immer das Gefühl, überzählig zu sein. Er ging in die Lehre, aber eine Abschlussprüfung machte er nicht. Verdienen musste er bald, und so suchte er sich einen Arbeitsplatz weit weg von seinem Heimatort. Damals fiel er noch nicht auf, unter der Woche hat er hart gearbeitet und am Wochenende ist er fortgegangen. Bei ein, zwei Bier blieb es aber nicht, auch nicht am Samstag als einzigen Fortgehtag.
Ferdinand ließ in der Arbeit nach, der Meister machte ihn darauf aufmerksam. In dieser Situation kündigte Ferdinand, denn so etwas ließ er sich nicht sagen. Trinken ja, aber dass er kein guter Arbeiter sei, das wollte er nicht auf sich sitzen lassen.
Er ging in die Stadt, er arbeitete da, arbeitete dort, immer in seinem Beruf, aber der Abstieg war nicht zu bremsen.
Auch die Obdachlosigkeit hat Ferdinand kennengelernt, er hat zwar immer auf sein Äußeres geschaut, hat sich rasiert und frische Wäsche besorgt, aber wenn er im Vollrausch seinen Unterschlupf nicht mehr erreichen konnte, nächtigte er eben im Freien.
Wenn er heute manchmal über den Kapitelplatz geht und die Sandler sieht, sieht er seine eigene Vergangenheit. Als er sich aus dem Mistkübel beim Würstelstand ernährte und über die mit Aktenkoffern vorbeieilenden Menschen nachdachte: "Was seid´s ihr für Idioten.“ Es sei beileibe nicht so gewesen, dass er während dieser Zeit nur gelitten habe, erzählt Ferdinand. Er hatte sehr viel Zeit für sich, und weil er ohnehin keine Chance für sich sah, brauchte er sich auch nicht anstrengen . . .
Bei einem Aufenthalt in Linz sieht er in einer Telefonzelle ein Pickerl mit Hinweis auf die Telefonseelsorge. "Ich hab mich damals schon vor dem eigenen Schatten gefürchtet“, erzählt Ferdinand. Irgendwie ist er aber doch auf die Idee gekommen, dort einmal anzurufen. Er wusste gar nicht genau, was er von denen wollte, aber reden, wenn er wieder einmal zu viel Alkohol erwischt hatte, das tat ihm schon gut.
So gut, dass er von Salzburg aus dann mit der Linzer Telefonseelsorge telefonierte. Bis er eines Tages im Suff die Nummer nicht mehr wusste und bei der Auskunft anrief. Mit der Dame von "08“ hat er gleich eine ganze Stunde gesprochen und dann erfahren, dass es in Salzburg "seit kurzem“ eine Telefonseelsorge gebe.
Damit begann eine Beziehung, die Ferdinand heute für entscheidend in seinem Leben hält. Er wurde zum "Daueranrufer“, wie in der TS-Statistik die regelmäßigen Anrufer bezeichnet werden.
"Das gibt es doch nicht, dass dem nicht zu helfen ist.“
Diese Einstellung der TS-Mitarbeiter spürte Ferdinand, und er wollte diese Menschen, die selbst ihm noch eine Chance gaben, nicht enttäuschen.
"Ich hab mir hinter jeder Stimme jemand vorgestellt, meistens eine Klosterschwester mit einem Mordstrum Kreuz umgehängt, guate Menschen, die für andere da sind“ erinnert sich Ferdinand.
Die "Kollegen“ vom Bahnhof haben natürlich bemerkt, dass der Ferdinand oft telefoniert. "Denen war zwar ein Pfarrer für den letzten Zwanziger gut genug, aber sonst haben´s an der Kirche kein gutes Haar gelassen. Wenn ich dann die Telefonseelsorge verteidigt hab, dann konnte das schon mit einem blauen Auge enden. Ich hab aber ein gutes Gefühl gehabt dabei, denn da hab ich wenigstens für die TS auch einmal etwas tun können.“
Immer und immer wieder besprachen die TS-Mitarbeiter mit Ferdinand Termine bei der Suchtkrankenberatung, er versprach hinzugehen, ging aber nicht, teils weil er es gar nicht mehr wußte, teils weil er sich einfach schämte. Er hatte nicht mehr die Kraft. Jede Menge geplatzte Termine, bis sich schließlich eine Mitarbeiterin erklärte, Ferdinand zur Beratung zu begleiten. Der Weg in die Klinik zur Entgiftung und Entwöhnung war aber noch mit Hindernissen gepflastert.
Ferdinand hatte noch eine Arbeit übernommen und stellte sich schon vor, wie er das verdiente Geld dann im Krankenhaus und danach in der Kur gut gebrauchen könnte. Nur leider machte er wieder eine alte Erfahrung. Wenn es ihm gut ging, kam der große Absturz.
In diesem Fall blieb vom Geld nicht viel, weil er das meiste schon während der Arbeit in Alkohol umgesetzt hatte, und die grenzenlose Enttäuschung über sich selbst ertränkte er dann in Alkohol, den er sich vom letzten Geld gekauft hatte.
In dieser Situation war nun wieder die TS "der Grabstein, bei dem ich mich ausgeweint habe“. Es war ein Samstag, und der Termin in der Klinik war am Montag – so ferne für einen Alkoholiker.
Da ergriff wieder eine TS-Mitarbeiterin die Initiative und verschaffte Ferdinand einen Aufnahmetermin. "Wie ich dann auf dem Klappsesserl in der Klinik gesessen bin, wollt´ ich noch einmal abhauen.“
"Als ich aber dann in einem so schönen weißen Bett gelegen bin, hab ich schon geglaubt, dass auch für mich einmal die Zeit mit dem Alkohol vorbei sein könnte. Was würden denn die von der TS sagen, die mir dieses schöne weiße Bett verschafft haben, wenn ich dann wieder zum Saufen anfang, die kann ich doch nicht enttäuschen.“
Wie einen Refrain sagte sich Ferdinand das vor, und er wußte, dass er sich auf die TS verlassen kann. Die nächste bittere Pille kam, als bei Ferdinand Tuberkulose festgestellt wurde. Als er aber angesichts der Diagnose Krebs nicht zum Glas griff, hatte er ein erstes Erfolgserlebnis. "Wennst bei so einer Watschen nicht zum Saufen anfangst, saufst dein Lebtag nimmer.“ Die damalige Einschätzung sollte sich bewahren. Mit einer Ausnahme, als er in einem Gasthaus versehentlich kein alkoholfreies, sondern normales Bier bekam, hat Ferdinand seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr getrunken.
Nach der Entgiftung in der Klinik kam wieder ein Hindernis, die Jahreskur in der Schweiz verzögerte sich, und die Klinik konnte ihn nicht mehr länger behalten, er brauchte einen Platz, wo er arbeiten konnte und nicht im Kreis seiner Freunde der ständigen Gefahr des Rückfalls ausgesetzt war. Wieder waren es die Mitarbeiter der Telefonseelsorge, die ihm Arbeit und Quartier beschafften. Er lebte sich so schnell in diese Interimslösung ein, daß es ihm der Abschied, als der Termin für die Kur in der Schweiz kam, schwer fiel.
Seine handwerklichen Fähigkeiten konnte Ferdinand in dem Kurheim einsetzen, er war Leiter einer Arbeitsgruppe, besuchte die Abendschule für Sozialarbeit und träumte davon und träumte davon, Ergotherapeut zu werden.
Trotz Bilderbuchgeschichte, aus diesem Traum wurde nichts. Als Ferdinand nach seiner Heimkehr aufs Arbeitsamt ging und sich nach der Berufsausbildung für Ergotherapeuten erkundigte, wußte man dort nicht einmal, was das sein sollte.
So kehrte Ferdinand wieder zu seinem Handwerk zurück, machte seinen Führerschein, holte die Gesellenprüfung nach , absolvierte die Meisterprüfung und gründete schließlich seine eigene Firma.
Es klingt wie im Märchen, und irgendwie hat es Ferdinand auch satt, so als Paradepferd hergezeigt zu werden, aber glücklich über seinen Weg ist er schon. Probleme gibt es auch jetzt, etwa die Schwierigkeit von Kontakten für Menschen, die keinen Alkohol trinken, oder die Frage, die er sich immer häufiger stellt: Wie ist es möglich, als Unternehmer Mensch zu bleiben?
Von Elisabeth Mayer – ORF-Salzburg
Kommentare zu "Interview"
Es sind noch keine Kommentare vorhanden
Kommentar schreiben
Möchten Sie dem Autor einen Kommentar hinterlassen? Dann Loggen Sie sich ein oder Registrieren Sie sich in unserem Netzwerk.
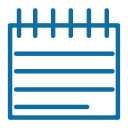 22.04.2024
22.04.2024
 4
4
 14
14
 268
268
 Besonders empfehlenswerte Werke:
Besonders empfehlenswerte Werke: